„Ich bin eine Nomadin“ heißt das neue Buch von Ayaan Hirsi Ali. Die autobiographische Streitschrift ist ein intimes Plädoyer für individuelle Freiheit und eine scharfsinnige Analyse des reaktionären Islam – und erleidet einen frappierenden Blackout, wenn es um die Frage geht, wie diesem beizukommen sei.
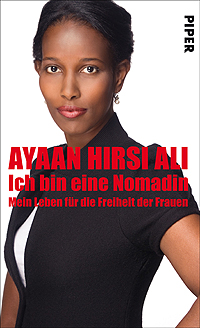
Wenn Ayaan Hirsi Ali den Propheten zitiert, kann das nur in eindeutiger Absicht geschehen: „Ich schaute auf den Paradiesgarten und bemerkte, dass die meisten seiner Bewohner die Armen waren. Ich schaute auf das Höllenfeuer und bemerkte, dass die meisten seiner Bewohner Frauen waren.? Diesen Hadith (eine überlieferte Aussage, die dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird) stellt sie ihrem jüngsten Werk voran – und nimmt damit eigentlich vorweg, was sie auf den folgenden 350 Seiten belegen will: dass die Unterdrückung der Frau ein Strukturmerkmal des Islam ist ? im Koran wie in der Praxis.
Nun wird kaum jemand zu Hirsi Alis neuem Buch greifen in der Erwartung, dass an diesem Fazit ein Zweifel bestände. Schließlich hat sie sich, vor allem mit ihrem autobiographischen Bestseller „Mein Leben, meine Freiheit“ (2006), durch Islamkritik aus Genderperspektive weltweit einen Namen gemacht. „Ich bin eine Nomadin“, als deutsche Ausgabe im April im Piper Verlag erschienen, knüpft an dieses Konzept an. Dabei bedient sich Ali ihrer bewährten Methodik: sie greift persönliche Erlebnisse und Anekdoten aus dem Kreis ihres somalischen Clans auf, verbindet sie mit gesellschaftlichen Beobachtungen und zieht daraus politische Schlüsse.
In klarer, flüssiger Sprache bewegt sie sich durch sieben Länder auf vier Kontinenten und ihre inzwischen 40 Lebensjahre, lässt Rückblenden ebenso mit einfließen wie Reflexionen. Das Mosaik, das sich daraus ergibt, ist alles andere als willkürlich: nicht allein auf erzählerischer Ebene passen die einzelnen Elemente ineinander, sie ergeben auch inhaltlich ein dichtes Netz der Anschuldigungen, in dem jedes Detail seinen Platz und eine klare Funktion hat: Zeugnis zu geben davon, wie der autoritäre Islam die individuelle Freiheit unterdrückt.
Im Unterschied zum ersten Teil ihrer Autobiographie hat Ayaan Hirsi Ali den Fokus allerdings erweitert: leitete sie einst ihre schwerwiegenden Anschuldigungen vor allem aus ihrer eigenen Geschichte ab, aus der Genitalverstümmelung, der zu Hause erlittenen Gewalt, der Zwangsheirat mit einem entfernten Cousin, dient jetzt die gesamte Familie als Quelle für Beweismaterial. Doch hinter der Darstellung der Familienverhältnisse steckt mehr: Während wir die Protagonistin in der Sache als unverändert stark erleben, als unnachgiebige Kämpferin gegen religiös verbrämte Unterdrückung, steht sie privat an einem kritischen Punkt: eines der Leitmotive von „Ich bin eine Nomadin“ ist der Tod ihres Vaters.
Der ergreifende Abschied in einem Londoner Krankenhaus, die Erfahrung, dass die Liebe zwischen Tochter und Vater tiefer reicht als der Graben, der sich durch ihren öffentlichen Abfall vom Glauben einst zwischen ihnen auftat, ist eine hoffnungsvolle Quintessenz des Buchs. „Als es darauf ankam, hat er seine Hingabe an die Gebote seines unversöhnlichen Gottes weichen lassen für seine Gefühle von väterlicher Liebe.“ Abgesehen von dieser Erkenntnis hinterlässt der Vater Ayaan vor allem mit Fragen. Sie befindet sich mitten in einem vorsichtigen Widerannäherungsprozess an ihre Familie, die jahrelang jeglichen Kontakt mit ihr abgelehnt hatte. Dabei läuft sie jedoch des Öfteren schmerzhaft gegen Wand. „Ich bin`s. Leg bitte nicht auf, Mutter“, fleht sie unsicher bei ihrem ersten Anruf. Für die Mutter ist die Sache sonnenklar: „Allah hat dich zu mir zurück gebracht“, ist die trockene Antwort, um bald darauf zu fragen: „Betest und fastest du, und liest du den Koran?“ Und als Ayaan all das verneint, schreit die Mutter: „Ungläubige! Du hast Gott und alles was gut ist verlassen, und du hast deine Mutter im Stich gelassen! Du bist verloren!“ Und legt auf.
Anekdoten wie diese zeigen Ayaan Hirsi Ali, eine der bekanntesten liberalen Publizistinnen der Gegenwart, in der Konfrontation mit einer Vergangenheit, die sie hinter sich gelassen glaubte. Aller weltweiten Anerkennung, allen Auszeichnungen zum Trotz zeigt sie sich in solchen Momenten von einer Fragilität, die manche Leser überraschen mag, und deren Elemente sie schonungslos reflektiert: die Schuldgefühle gegenüber der Mutter, die Selbstvorwürfe, der vorübergehende Rückfall in die Verhaltensmuster der Adoleszenz. Dazu kommt eine Zerrissenheit, die keineswegs nur auf die intellektuelle Ebene beschränkt bleibt: Von den Gerüchen auf einem Londoner Straßenmarkt im somalischen Viertel Whitechapel bekommt sie „Heimweh“. Doch als sie die verschleierten Frauen dort sieht, schlägt dies um in „ein Gefühl von Ersticken“.
Das Buch zeigt Ayaan Hirsi Ali in der Konfrontation mit einer Vergangenheit, die sie längst hinter sich gelassen glaubte.
Alles andere als stabil sind auch Ayaan Hirsi Alis räumliche Koordinaten. Die Niederlande schienen der Hafen, in dem sie angekommen war, nach ihrer „Reise vom Land des Glaubens ins Land der Vernunft“, wie es im vorigen Buch hieß. Nachdem man ihr dort wegen falscher Angaben beim Asylantrag den Pass entzog, findet sie sich als Mitarbeiterin des konservativen Think Tank American Enterprise Institute in Washington wieder. Doch der Verlust der Wahlheimat wiegt schwer, Ali hängt ihren Erinnerungen an Freundschaften, Radtouren durch die Dünen und Pommes Rot-Weiß im Badeanzug nach und konstatiert: „Nirgendwo war ich so glücklich wie dort.“ Das Ankommen in den USA kostete sie dagegen Mühe: „Ich fühlte mich entwurzelt und verloren. Es hatte immer romantisch geschienen, eine Nomadin zu sein. In der Praxis ist ein heimatloses Dasein in dem man ständig unterwegs ist ein Vorgeschmack auf die Hölle.“
Solcherlei intime Einblicke passen zum autobiographischen Anspruch Ayaan Hirsi Alis. Wie gewohnt bietet dieser vor allem den empirischen Rahmen für ihre politische Argumentation. Die Bindeglieder heißen Struktur und Kultur. Ihre eigene Familie, so Ali, stehe stellvertretend für zahllose Andere, und deren dysfunktionale, repressive Tendenzen seien keineswegs persönlichen Unzulänglichkeiten geschuldet, sondern der fundamentalen (Geschlechter-) Ungleichheit, die der Koran propagiere. Eine neurotische Sexualmoral, unzureichendes Verantwortungsgefühl und die Akzeptanz von Gewalt zur Sicherung autoritärer Verhältnisse stellen ihr zufolge wesentliche Hindernisse bei der Integration muslimischer Einwanderer in westlichen Ländern dar.
Zweifellos kann man Ali vorwerfen, hier mit einem allzu eindimensionalen Kulturbegriff zu operieren und 1,5 Milliarden Anhänger einer Religion über einen Kamm zu scheren. Weder neu noch von der Hand zu weisen ist indes ihr Argument, dass sich diese allesamt auf ein Buch beziehen, das die Unterdrückung der Frau ebenso legitimiere wie Gewalt gegen Ungläubige, Juden und Abfällige. Ali verwirft daher die in den letzten Jahren in Mode gekommenen Versuche einer „Neuinterpretation“ des Koran und wirbt stattdessen für eine schonungslose Kritik des heiligen Buchs. Diese soll die Grundlage bieten für das von ihr propagierte großflächige Emanzipationsprojekt: „Die Aufklärung des muslimischen Denkens“.
Eben dafür sucht sie im Schlussteil des Buchs nach Mitstreitern – und zieht einen befremdlichen Schluss: Europas Intellektuelle verwirft sie aufgrund ihrer kulturrelativistischen Tendenzen, an die Feministinnen richtet sie trotz aller bisherigen Enttäuschung einen glühenden Appell, die Befreiung der muslimischen Frau endlich ebenso zu unterstützen wie einst die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Ausgerechnet die christlichen Großkirchen aber fordert sie auf, in den westlichen Ghettos soziale Einrichtungen betreiben und der islamischen Mission mit ihren eigenen Mitteln das Wasser abzugraben. „Wahabiten sollen auf dem Markt von Trost und Glauben nicht die einzigen Anbieter sein?, so Ali, die – ganz klassische Liberale – das Konzept des barmherzigen Gottes für attraktiver hält als das des gestrengen Allah. Sie selbst erklärt sich indes weiterhin als Atheistin, die in der anvisierten Kooperation nicht mehr als ein Zweckbündnis sieht.
Man mag der Idealistin Ayaan Hirsi Ali bei diesem realpolitischen Einbruch zu Gute halten, dass sie das Buch vor der jüngsten Welle an Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche schrieb. Auch Ali selbst scheint hier Erklärungsbedarf zu sehen, räumt die klerikale Fundamentalopposition zur Aufklärung ein, die Verfolgung von Hexen und Ketzern, die repressive Sexualmoral der Katholiken. Dennoch hält sie die christlichen Institutionen für geläutert und, zumal verglichen mit dem Islam, vor allem zur kritischen Auseinandersetzung für fähig, was sie als Bündnispartner qualifiziere.
Vielleicht hätte Hirsi Ali besser daran getan, sich anstelle dieses abenteuerlichen Ausritts einzugestehen, dass auch sie keine Lösung hat. Es ist frappierend zu sehen, wie sie sich ihrer sonstigen Nuanciertheit und Reflexion zum Trotz in Spekulationen über die „zivilisierende Wirkung“ katholischer Einrichtungen verliert und diese mit dem Vergleich „wie in Afrika zur Zeit des Kolonialismus“ abrundet.
Im Rest des Buches schlägt sie dagegen Töne an, die in der gängigen Islamdebatte meist viel zu kurz kommen. Sie kritisiert totalitäre Inhalte, zieht aber nicht den Schluss, die Grenzen zu schließen oder muslimische Einwanderer abzuschieben. Sie sieht Kultur nicht als biologisch an, sondern erkennt ihren dynamischen Charakter: „Der Islam steckt nicht in den Genen. Nur weil die Eltern aus Marokko kommen, muss ein in den Niederlanden geborenes Kind noch kein Muslim sein.“ Und westlichen Multikulturalisten hält sie vor, gerade die Annahme sei rassistisch, Muslime könnten sich nicht aus ihrem Glauben befreien.
Ayaan Hirsi Ali – Ich bin eine Nomadin. Mein Leben für die Freiheit der Frauen. Piper Verlag, 352 Seiten.




