Jessica Mawuena Lawson erzählt in ihrem Debütroman „Kekeli“ von einem Mädchen, dessen Leben sich verändert, als ihre Cousine Afi aus Togo zu Besuch kommt. Sie beginnt ihre afrodeutsche Familie und ihre eigene Zugehörigkeit zu hinterfragen und entwickelt gleichzeitig erste Liebesgefühle zu ihrem Mitschüler Kwame. „Kekeli“ ist ein einfühlsamer und berührender Coming-of-Age-Roman.

Jessica Mawuena Lawson arbeitet in einer Unterkunft für Geflüchtete sowie als freie Sensitivity-Readerin und Lektorin. Sie studiert Literatur- und Kulturtheorie. (© Nane Diehl)
Ich habe so viele Gesichter. Manchmal wundere ich mich selbst darüber, dass ich nicht durcheinanderkomme. Als ich ihr gegenüber- stehe, bin ich mir allerdings unsicher, welches ich wählen soll. Da ist etwas an ihr, das ich nicht greifen kann.
Mein Vater, der im engen Flur vor mir steht, schüttelt ihr ausgiebig die Hand. Er sagt ein paar kurze Sätze auf Ewe. Mir fehlen die Worte, um mir in seiner Muttersprache ein Zuhause zu bauen. Deswegen stehe ich sprachlos hinter ihm und beobachte ihre Reaktion. Sie lächelt. Ihr kantiges Gesicht wird dabei runder, irgendwie weicher. Sie antwortet und klingt sehr höflich.
Wie alt sie wohl ist? 23 vielleicht? Damit wäre sie sechs Jahre älter als ich. Heißt das, dass ich im Umgang mit ihr auf irgendwas achten muss?
Hinter ihr taucht Tante Eugenie im Türrahmen auf. Es ist schon Ewigkeiten her, dass wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Die Zeit hat sich in ihre Mundwinkel und in ihre Stirn gegraben. Dieselben Linien und Abzweigungen deuten sich bereits auf Papas Gesicht an.
»Hallooo ihr beiden«, sagt sie in einer Art Singsang und winkt energisch. »Kommt rein!«
Sie machen uns Platz, Tante Eugenie und meine Cousine, die noch gestern über 4800 Kilometer von uns entfernt war. Was ist wohl ihr erster Eindruck von Deutschland?
Papa und ich ziehen unsere Schuhe aus, auch wenn Tante Eugenie darauf besteht, dass wir sie anlassen. In dem Zimmer, das mal als Wohn- und mal als Esszimmer dient, setzen wir uns auf die schwarze Ledercouch.
Nichts hat sich verändert: Das Kreuz hängt immer noch direkt über dem lautlos laufenden Fernseher, und neben den Holzmasken reihen sich die christlichen Heiligenbilder und gepressten Blütenkonstellationen ein. Auch die Fenstervorhänge und die Sofakissen sind noch aus demselben grünen Stoff. Ich merke, dass ich meine Schultern hochgezogen habe und lasse sie sinken. Nach all den Jahren fühlt sich wenigstens dieser Raum vertraut an, nach still sitzen und die Erwachsenen beobachten, nach immer neuen Leuten, nach Musik, wenn es zur Stimmung passt und nach Dèguè, das ich als Kind so gern gegessen habe und das es nur bei Tante Eugenie gab.
Meine Tante stellt uns einander auf Französisch vor. »Meine Tochter«, sagt sie zu mir. »Das ist deine Cousine Afi. Jetzt, wo sie hier ist, kannst du ihr alles zeigen, ja? Sie ist deine große Schwester – aber hier in Deutschland bist du die Ältere.« Sie lacht.
Ich nicke und sage nur »Ja, natürlich!«, weil ich meinem Schulfranzösisch nicht ganz über den Weg traue. Afis Gesicht bleibt reglos.
Dann geht das Gespräch in Ewe über.
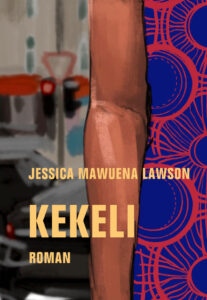
(© Verbrecher Verlag)
Ich beobachte Afi und hoffe, dass sie es nicht bemerkt. Sie hat kurze schwarze Haare. Ihre Löckchen sind so dicht, dass die einzelnen Haarsträhnen nicht mehr erkennbar sind, und ihre Augen absorbieren mehr, als sie abgeben. An den richtigen Stellen scheint sie zu antworten, sie lächelt nicht viel – aber doch jedes Mal, wenn Tante Eugenie etwas sagt und dann lacht. Papa ist zuerst sehr verhalten, aber im Verlauf des Gesprächs werden seine Gesten größer und auch seiner Stimme erlaubt er, mehr Raum einzunehmen, wie immer, wenn er Ewe spricht. Und er stottert nicht. Trotzdem fallen mir Lücken in seinen Sätzen auf, Tante Eugenie oder Afi werfen ihm dann die Wörter zu, die er in dem Moment nicht findet.
Papa spricht nicht viel Ewe in seinem Alltag – auf seiner Arbeit gibt es keine anderen Togoles:innen, und weder Mama noch meine große Schwester oder ich könnten ihm Gesprächspartnerinnen sein.
Ich lausche der Unterhaltung, ohne sie zu verstehen, und frage mich, ob es sich so für meinen Vater angefühlt hat, als er gerade neu nach Deutschland gekommen war – so unmöglich, je Kontakt aufnehmen zu können. Je wirklich verstehen zu können.
Irgendwann steht meine Tante mit einem leisen Ächzen auf, das mehr nach Gewohnheit als nach Schmerz klingt.
In ihren Hausflipflops flappst sie in die Küche. Sie ist eine große Frau mit vielen Kurven. Während sie läuft, hebt sie ihre Füße kaum an; ihre Fersen scheinen nie den Kontakt zum Boden zu verlieren. Die Küche ist vom Esswohnzimmer nur durch eine Küchenzeile abgegrenzt.
Sobald Tante Eugenie das Gespräch verlassen hat, wird es still. Papa lehnt sich ins Sofa zurück, Afi wendet sich dem Kastenfernseher zu, der auf einer niedrigen Vitrine steht. Die Wiederholung irgendeiner Castingshow läuft, der Sänger singt, die Adern an seinem Hals sind angeschwollen – doch bei uns kommt nichts an. Afi greift nach der Fernbedienung und erhöht die Lautstärke. Nun übertönt sein Lied unser Schweigen. In meinem Kopf schiebe ich Gesprächsanfänge hin und her, ohne fündig zu werden. Vielleicht ist diese Situation zu groß für Small Talk?
Ich schaue mir die Linien in meinen Handflächen an und versuche, den Pulsadern zu folgen, die ich gerade so erahnen kann. Wie kann sich Familie so unbekannt anfühlen?
Das Geschirrklappern, das aus der Küche dringt, nehme ich – wie eine Filmklappe – als Signal, aufzustehen und Tante Eugenie in die Küche zu folgen, um ihr Hilfe anzubieten. Wenigstens die Rolle der guten Tochter kenne ich auswendig.
Tante Eugenie lächelt und wiegt ihren Kopf, als ich die Küche betrete. »Nein, setz dich, setz dich!«, sagt sie. »Ich bin gleich fertig.« Aber an dem Glitzern in ihren Augen kann ich erkennen, dass mein Angebot gut bei ihr angekommen ist. Also bleibe ich und warte, bis eine Aufgabe für mich abfällt.
»Und«, sagt Tante Eugenie, während sie in einem großen Topf das Maismehl anrührt, »wie läuft es in der Schule?«
Das ist die typische Einstiegsfrage der allermeisten Erwachsenen, die ich kenne. Eine Frage, auf der – je nach Antwort – ein neues Thema aufgebaut wird. Für meine Tante aber ist es die Frage. Schulnoten sind alles entscheidend.
»In der Schule läuft es gut«, erzähle ich deswegen hastig. »Jetzt nach der mündlichen Prüfung ist nicht mehr viel zu tun. Eigentlich warten wir alle nur noch auf die Zeugnisse und den Abiball in 13 Tagen.«
Vor dem großen, stillen Streit zwischen Papa und Tante Eugenie hat Papa seiner großen Schwester regelmäßig Kopien unserer Schulzeugnisse geschickt. Für mich war das kein größeres Problem, die Schule fällt mir leicht. Aber für meine Schwester Jacky, die mittlerweile weit weg von uns in Berlin wohnt, ging jedes Mal die Welt unter, wenn sie mit zitternden Händen den Telefonhörer entgegennehmen musste. Wie ein begossener Hund stand sie da, während statt Regen Tante Eugenies endloser Monolog auf sie einprasselte. Meistens stand ich mit flauem Gefühl im Magen neben ihr. Jedes energisch gesprochene Wort am anderen Ende der Leitung konnte ich verstehen, so laut sprach Tante Eugenie ins Telefon.

