Der temporäre Mieter*innschutz der Regierung und ihre Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus, die gestern in einer Pressekonferenz vorgestellt wurden, sind nur Tropfen auf den heißen Stein.
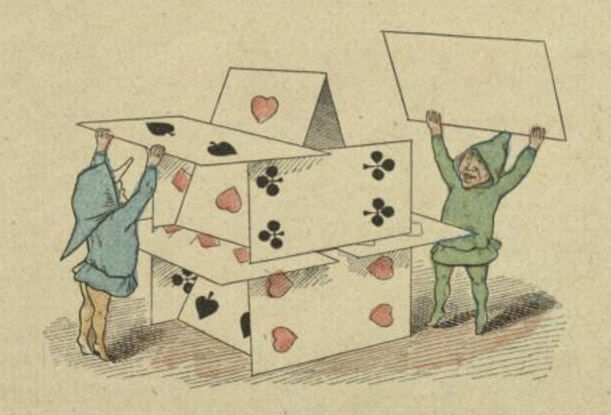
[Public domain]
Mieterhöhungen sind bis Ende des laufenden Jahres verboten. Das Räumungsrecht der Vermieter*innen ist bis zum Ablauf des „état de crise“ im Juni aufgehoben. „Pendant l’état de crise, personne ne sera mis à la rue“, heißt es hierzu im Pressedossier des Wohnungsbauministeriums. Diese Maßnahmen bergen Risiken, denn die Eigentümer*innen können die Miete Anfang 2021 wieder um bis zu fünf Prozent des aktuellen Immobilienwerts (Anschaffungspreis plus Instansetzungskosten) ihres Mietobjekts erhöhen – und das, obwohl die wirtschaftlichen und sozio-ökonimischen Langzeitfolgen der Krise noch ausstehen. Außerdem steht die Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle im Raum, die widerrum noch nicht absehbare, aber zwangsläufig Konsequenzen mit sich bringt. Nachhaltiger Mieter*inneschutz sieht anders aus.
Andere Maßnahmen spielen auf lange Sicht gar den Eigentümer*innen in die Karten. Die Mietzuschüsse für geringverdienende Haushalte wurden dauerhaft erhöht. Die Anzahl der Wohngeldempfänger*innen ist seitdem um 50 Haushalte gestiegen, wie Kox gestern berichtetet. Ein Haushalt kann monatlich maximal 294 Euro Beihilfe erhalten. Ein Blick auf die Mietpreise in Luxemburg genügt, um zu wissen, dass das unzureichend ist. Unabhängig davon vermittelt das Ministerium mit dieser Maßnahme vor allem eins: Dass es in Ordnung ist, horrende Mietpreise auf dem Privatmarkt zu verlangen. Die Wichtigkeit und Dringlichkeit, Menschen in prekären Lebenssituationen finanziell zu unterstützen steht außer Frage, doch löst das nicht das eigentliche Problem. Es ist Symptombekämpfung.
Was sich ändern muss: Die Tatsache, dass 90 Prozent des Baulandes Privateigentum sind. Die öffentlichen Grundstücke wurden wohlgemerkt mit Steuergeldern bezahlt und das zu den gängigen, hohen Marktpreisen. Auch dieser Umstand unterstützt einen Immobilienmarkt, der für Durchschnittsbürger*innen und Geringverdiener*innen zunehmend unzugänglich wird. Das Wohnungsbauministerium kommt jetzt mit dem „fonds spécial de soutien au développement du logement“ daher, der im April 2020 entstanden ist. Der Fonds soll die Planung und die Finanzierung öffentlicher Wohnungsbauprojekte erleichtern. In dem Sinne, dass letztere unabhängig vom alljährlichen Staatsbudget umgesetzt werden können. Erschreckend, dass es erst jetzt zur Entstehung eines solchen Fonds kommt – zweieinhalb Jahre nach Beginn der Legislaturperiode der derzeitigen Regierung. Zusammen mit dem „comité d’acquisition“ des Finanzministeriums soll jedenfalls effizienter auf öffentlichen Wohnungsbau hingearbeitet werden. Kox gab in der gestrigen Pressekonferenz an, dass bis dato drei von zwanzig angeboten Grundstücken erworben wurden. Über die Bekämpfung von Leerstand verlor er kein Wort.

Luxemburg ist in einer Krisen-Matriochka gefangen. Copyright: Igor Drondin (Pixabay)
Neben den Maßnahmen, die während der Corona-Krise ergriffen wurden, stellte Kox auch das Vorzeigeprojekt „Elmen“ hervor. Das Ministerium steckt 76 Millionen in das Wohnprojekt zwischen Kehlen, Mamer und Koerich. Das entspricht 28 Prozent der Gesamtkosten. Am Ende ist dennoch nicht mal die Hälfte der Wohnfläche in öffentlicher Hand: 57,83 Prozent sind „domaine privé“ und 42,17 Prozent „domaine public“. Die subventionierten Wohnungen in Elmen sollen vierzig Jahren im öffentlichen Besitz bleiben, was klar Kox´ Wunsch widerspricht, dass öffentliche Wohnräume auf ewig auch solche bleiben.
„Elmen“ wird ein ländliches Wohngebiet, das Lebensraum für über 2.200 Menschen schafft. Der Fokus bei der Landesplanung und dem Bau: Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Wann das Ganze steht? Voraussichtlich in zehn bis fünfzehn Jahren. Bis dahin wurde das öffentliche Verkehrsnetz hoffentlich optimiert, ansonsten liegt Elmen mitten im Nirgendwo und ist schlecht mit den Öffentlichen erreichbar. Im Moment konzentriert sich der Streckenausbau vornehmlich auf den Süden, das Zentrum und den Norden des Landes. Andere öffentliche Wohnbauprojekte, wie „Wunne mat der Wooltz“ in Woltz oder „Neischmelz“ in Düdelingen, seien übrigens noch nicht weit fortgeschritten, sagte Kox in der Pressekonferenz.
Luxemburg ist in einer Krisen-Matriochka gefangen, wenn sich an der Wohnungspolitik nicht grundlegend was ändert und dem Wohnungsbauministerium nicht mehr als nur läppische 1,15 Prozent des Gesamtbudgets des Staates zugutekommen. Das Zusammenspiel der sanitären Krise und der Wohnungskrise ist gefährlich: Beide bergen soziale und wirtschaftliche Krisen, denen es langfristig und mit fundamental neuen Denkansätzen entgegenzuwirken gilt. Nicht die Regeln, sondern das Spiel muss verändert werden.




