Die Bundesregierung ist Vorreiterin bei neuen Gesetzen gegen Hassrede. Doch es gibt erhebliche Zweifel an deren Wirksamkeit, wohingegen die Nebenwirkungen alles andere als harmlos sind.
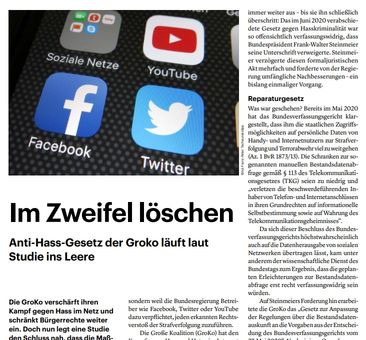
ct 9/2021
„Mit der Einführung des NetzDG haben wir dafür gesorgt, dass Hass und Hetze im Netz konsequenter und effektiver begegnet wird“, erklärte die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) im September 2019. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz trat 2018 in Kraft und sollte die sozialen Medienplattformen zwingen, strafbare Inhalte zügig zu löschen. Unter Hinweis auf einen Evaluierungsbericht verkündete die Ministerin: „Das NetzDG wirkt!“ Weil es aber noch „Verbesserungsbedarf“ gebe, habe sie zusätzlich ein Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität ausgearbeitet.
Die jüngste Ausgabe des Technikmagazins ct bewertet Lambrechts Gesetzesarbeit ganz anders: Unter dem Titel „Im Zweifel löschen“ wird auf Ineffizienz und Nebenwirkungen des NetzDGs hingewiesen und vor den Auswirkungen des neuen Anti-Hass-Gesetzes gewarnt. Auslöser für die Kritik ist eine Ende März veröffentlichte Studie der Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur Leipzig (HTWK), die eher darauf hindeutet, dass das NetzDG überhaupt nicht wirkt.
Anti-Hass-Gesetz mit Hindernissen
Auch das von der Ministerin hochgejubelte Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität hat mittlerweile an Glanz verloren. Nachdem die große Koalition den Text verabschiedet hatte, verweigerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) seine Unterschrift – aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht hatte nämlich bei einem anderen Gesetz (zur Terrorabwehr) befunden, die Schnüffelei greife viel zu stark in die Privatsphäre ein. Die ct fasst zusammen: „Kern der neuen Regelung [im Anti-Hass-Gesetz] ist: Polizei und Justiz sollen Bestands und Nutzungsdaten, die Unternehmen zu Bürgern verwahren, leichter abfragen können. Die Regierung fährt bürgerrechtliche Schutzschranken damit weiter herunter.“
Die große Koalition rang sich dazu durch, mit einem Zusatzgesetz die Regelungen über die Bestandsdatenauskunft in mehreren Gesetzen abzuändern, um der Kritik des Bundesverfassungsgerichts Rechnung zu tragen. „Die Abfragemöglichkeiten sind nun etwas eingeschränkt“, schreibt die ct, rechnet aber nun mit einer „Flut von Meldungen zu rechtswidrigen Inhalten in sozialen Netzwerken“, die Bundeskriminalamt und Gerichte überlasten könnte. Denn die Plattformen werden durch das neue Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität dazu verpflichtet, illegale Inhalte nicht nur zu löschen, sondern auch den Strafverfolgerungsbehörden zu melden.
Was das NetzDG bringt
Was die Bilanz des NetzDGs angeht, so ist das Leipziger HTKW-Team um Medienrechtler Marc Liesching zu anderen Ergebnissen gekommen als die Justizministerin. Die durchschnittliche Löschquote von gemeldeten und tatsächlich rechtswidrigen Inhalten auf Facebook, YouTube und Twitter sei gegenüber 2017 leicht gesunken.
„Das heißt aber nicht, dass in den sozialen Netzwerken weniger Beiträge gelöscht würden“, präzisiert die ct. Denn Facebook, YouTube und Twitter sind dazu übergegangen, massiv Beiträge zu löschen, die als konträr zu ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) eingestuft werden. Bei Facebook waren das laut HTKW im 2. Halbjahr 2020 im Bereich „Hassrede“ weltweit 49 Millionen Inhalte – 95 Prozent davon, bevor sie von User*innen gemeldet wurden.
Künstliche Intelligenz gegen Meinungsfreiheit
Liesching vermutet, dass dabei „auch Inhalte verschwinden, welche nach dem StGB nicht strafbar sind und auch in sonstiger Weise nicht gegen deutsches Recht verstoßen“. Dieses Overblocking gefährde die verfassungsrechtlich garantierte Meinungsfreiheit. Die Geldbußen und die engen Fristen des NetzDG führten nach Aussagen von YouTube zur Entscheidung, „Inhalte in fast allen Fällen im Zweifel zu löschen“, heißt es in einem Online-Beitrag auf heise.de (Nachrichtenportal des Heise-Verlags, in dem auch die ct erscheint).
Besorgniserregend ist auch, dass bei den Bewertungs- und Löschmechanismen immer stärker künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, mit der damit einhergehenden Intransparenz und dem Risiko einer Ungleichbehandlung. Weil die AGB-Filter meist den gesetzlichen Bestimmungen zuvorkommen, läuft das NetzDG „ins Leere“, wie die ct schreibt. Doch für ein „überflüssiges“ Gesetz richtet es im Bereich der Meinungsfreiheit ziemlich großen Schaden an.
Download der HTWK-Studie „Das NetzDG in der praktischen Anwendung“.
ct-Podcast zum Thema mit Marc Liesching: Das Auge des Sauron.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Apple am Pranger wegen App-Zensur
- Am Bistro mat der woxx #191 – Zwéngt den Digital Services Act déi grouss Internet-Plattformen an d’Knéien?
- Podcast: Am Bistro mat der woxx #058 – Déidlechen Hatespeech um Internet a Fat Acceptance
- Kritik an Google und Youtube verschärft sich
- #Freeturnup: Klibber eis Fred!




